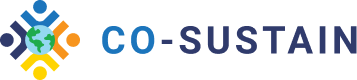Fallstudien
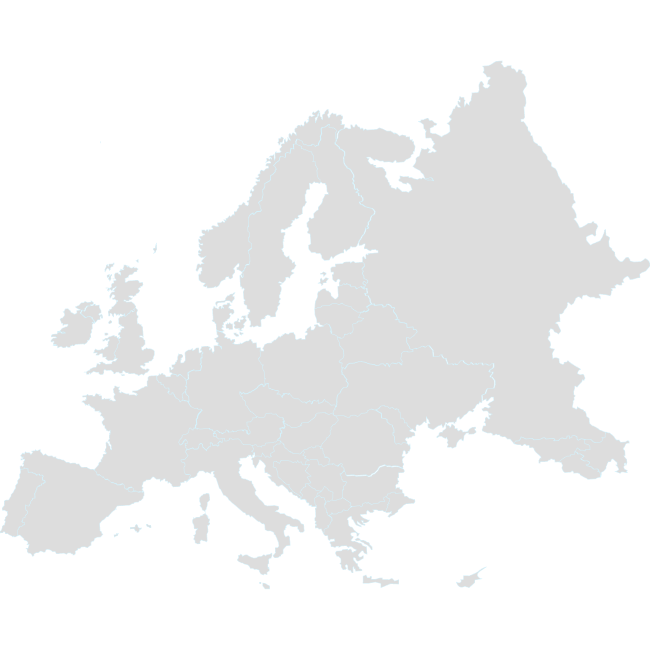


Case study #3 Espoo, Finland
Formal political participation – Participatory processes
promoted by government in Northern Europe

Case study #3 Tartu, Estonia
Formal political participation – Participatory processes
promoted by government in Northern Europe


Case study #1: Spain
Involvement – Spanish energy communities with a focus
on socioeconomic vulnerability and gender

Case study #1: Spain
Involvement – Spanish energy communities with a focus
on socioeconomic vulnerability and gender
Forschungsaktivitäten
Ziel der Forschung: Erproben von Interventionen zur gemeinsamen Erarbeitung von Lösungen in 4 Fallstudien, eine für jede Form der politischen Beteiligung.
Umfang der Forschung: CO-SUSTAIN wird Interventionen in einer Fallstudie für jede der latenten und manifesten Formen der politischen Beteiligung testen: Einbindung (ES), Engagement (IT), formale politische Beteiligung (EE, FI) und Aktivismus (AT).
Forschungsmethogie: Eine Vorbereitungsphase dient dazu, die Probleme und Herausforderungen in der jeweiligen Fallstudie kennenzulernen, neu zu identifizieren oder neu zu formulieren. Anschließend folgen drei deliberative Panels, um Hebel und Voraussetzungen für Veränderungen zu ermitteln und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.
Vorbereitungsphase: In der Vorbereitungsphase unterstützen qualifizierte Moderator*innen und/oder Forscher*innen die Teilnehmenden (Bürger*innen, lokale Behörden und andere relevante Interessengruppen) dabei, ihr Wissen über die klima-, politischen oder gesellschaftlichen Imperative, die im Mittelpunkt der anschließenden Gruppendiskussionen und Beratungsprozesse stehen werden, zu vertiefen. Diese vorbereitende Phase ermöglicht auch den Austausch verschiedener Perspektiven und Erfahrungen zu den jeweiligen Krisen, um so ein umfassendes Verständnis der Faktoren zu erlangen, die die politische Beteiligung ausgelöst haben.
Deliberationsphase: In der deliberativen Phase werden die Teilnehmenden ermutigt, die Voraussetzungen und Hebel für den Wandel mithilfe von Theory of Change und Partizipativem System Mapping zu identifizieren. Zwei deliberative Panels finden gleichzeitig statt, eines mit lokalen politischen Entscheidungstragenden und anderen relevanten Interessengruppen (äußere Dimension) und eines mit Bürger*innen (innere Dimension). Im letzten deliberativen Panel werden auf der Grundlage der Ergebnisse der Theory of Change und des Partizipativen System Mapping, die in den vorangegangenen Panels durchgeführt wurden, Roadmaps und Strategien zur Erreichung der erwarteten Ergebnisse für die vier Fallstudien entwickelt. Eine deliberative Arena wird eine strukturierte Diskussion über die Wege zu den Ergebnissen ermöglichen, um 1) die Schlüssigkeit und Machbarkeit der Szenarien/Roadmaps zu validieren, 2) Änderungen und Verbesserungen an den Theories of Change vorzuschlagen und 3) jene Strategien auszuwählen, die für den spezifischen Fall und Kontext am wahrscheinlichsten erfolgreich sind.

Fallstudie zur Einbindung
CS #1: Einbindung - Spanische Energiegemeinschaften mit Schwerpunkt auf sozioökonomischer Vulnerabilität und Gender
Energiegemeinschaft von Jabalcón: In Zújar (Granada) wurde die Initiative zur Gründung einer Energiegemeinschaft im Jahr 2021 von einer Gruppe von Einwohner*innen ins Leben gerufen und von der Energiegenossenschaft Cooperase und der Stadtverwaltung von Zújar unterstützt. Heute zählt die Gemeinschaft 33 Mitglieder, darunter Anwohner*innen, Genossenschaften, die Bewässerungsgemeinschaft und Vertreter*innen der Stadtverwaltung. 60 % der Teilnehmenden sind Frauen, Spanier*innen und gehören überwiegend der Mittelschicht mit mittlerem bis hohem Bildungsniveau an. Das System ist noch nicht in Betrieb, aber die Kooperative Nuestra Señora de la Cabeza hat ihr Gebäudedach für die Installation zur Verfügung gestellt, während Cooperase den Prozess auf der Grundlage der früheren Erfahrungen in Monachil unterstützt. Diese Fallstudie konzentriert sich auf die Befähigung von Frauen in ländlichen Gebieten, eine aktivere Rolle bei der Energiewende zu spielen, und auf die wichtigsten Hindernisse für ihre Beteiligung.
CS #1: Engagement - Energiegemeinschaften, die Schwächere einbeziehen

Energiegemeinschaft La Traginera: La Traginera ist ein städtisches Netzwerk sozialer Organisationen - Stiftungen, Genossenschaften und CSO - in Barcelonas Stadtteil Ciutat Vella, das in den letzten Jahren Projekte mit den Schwerpunkten Wohnungsbau, Bürgerbeteiligung, Sozialwirtschaft und gegenseitige Unterstützung in diesem sozioökonomisch vielfältigen Stadtteil durchgeführt hat. Sie arbeiten hauptsächlich daran, die lokale Entwicklung durch Bürgerbeteiligung zu stärken. Dieses Netzwerk will nun eine Energiegemeinschaft mit einem starken Fokus auf Anfälligkeit schaffen, da Ciutat Vella die höchste Konzentration von energiearmen Haushalten in der Stadt aufweist. La Traginera hat erfolgreich ein starkes Netzwerk von wichtigen Interessenvertretern aufgebaut, die die Installation von Photovoltaikanlagen fördern und einen Teil der erzeugten Energie an bedürftige Haushalte in der Nähe verteilen werden.
Fallstudie über bürgerschaftliches Engagement
CS # 2: Engagement - Lebensmittelsolidarität in Turin (IT)

Die Solidarietà Alimentare (Lebensmittelsolidarität) Die Solidarietà Alimentare (Lebensmittelsolidarität) ist eine freiwillige Organisation, die in Turin während der Covid-19-Lockdowns entstanden ist. Es handelt sich um eine Bewegung von Universitätsstudierenden, die sich an das CAAT (Agrifood Centre Turin) wandten, um überschüssige Lebensmittel zu finden, die sie während des Lockdown 2020 an bedürftige Familien verteilen wollten, zunächst in Zusammenarbeit mit der Supermarktkette Borello und später mit europäischen Mitteln, um Trockenlebensmittel und Hygieneartikel zu kaufen und zu verteilen. Auf operativer Ebene kontaktierten die Studierenden jeden Freitag CAAT und trafen sich mit Vertreter*innen von Migrant*innengemeinschaften, die als Vermittler*innen fungierten. Food Solidarity schloss mit der Stadt Turin eine Vereinbarung über Interventionen im Zusammenhang mit der Bewältigung der gesundheitlichen Notlage durch Covid-19 (Verteilung von Lebensmitteln und lebensnotwendigen Gütern sowie soziale Mediation und Nachbarschaftsaktionen) in Zusammenarbeit mit Vereinigungen, die ausländische Gemeinschaften einschließen oder seit langem im Bereich der sozialen Integration tätig sind. Ziel der Untersuchung ist es, die soziale und relationale Dynamik zu rekonstruieren, die dazu geführt hat, dass sich eine begrenzte Anzahl von Personen außerhalb der Institutionen und ohne Anleitung durch die Behörden autonom in der Zivilgesellschaft organisiert hat, um auf die durch die Pandemie entstandene soziale Notlage zu reagieren. Ein weiteres Ziel besteht darin, die Wechselwirkung dieser Phänomene mit den lokalen Behörden zu analysieren und deren Fähigkeit zu bewerten, die soziale Reaktion auf die von Covid-19 verursachte Nahrungsmittelkrise und die zur Bewältigung der Krise erforderlichen Distanzierungsmaßnahmen zu erkennen, zu verbessern und zu koordinieren.
Fallstudie zur formalen politischen Partizipation
CS #3: Formale politische Beteiligung - Von der Regierung geförderte partizipative Prozesse in Nordeuropa


Annelinna District in Tartu, climate-resilient urban greening: This case study focuses on the Annelinna district in Tartu, an area characterized by green spaces owned by the City of Tartu and apartment buildings managed by housing associations. The district also hosts various community facilities, including a library, a daycare center, and other institutions. The local government, in partnership with the University of Tartu and other stakeholders, aims to establish self-sustaining systems that support biodiversity development. Residents from diverse socio-economic and cultural backgrounds are actively involved in designing landscape interventions, ensuring their participation throughout planning, implementation, and maintenance phases. A wide range of organizations are engaged as key partners, such as public institutions (universities, schools, clinics, museums), private sector entities (real estate agencies, landscape maintenance providers, gardening centers, landscape architectural firms, media), and non-profits (such as apartment owners’ associations and numerous citizen initiatives). Launched in autumn 2022, the initiative is currently in the negotiation and planning stages. The project fosters unique participatory pathways that are designed to be evaluated and potentially adapted for use in other contexts. For example, designated intervention pilots will be used to enhance climate education and literacy among residents, while also providing training opportunities for stakeholders. The overarching goal is to disseminate knowledge, successfully implement biodiversity programs, and build need-based community networks that support the green transition. Through this case study, the University of Tartu seeks to collaborate with the local community to increase the district’s resilience against climate change impacts such as summer heatwaves and more frequent intense storms. To adapt apartment buildings to changing climate conditions, the project explores opportunities for nature-based solutions that help regulate temperature and humidity, balancing the urban microclimate effectively.
Kleine modulare Reaktoren (SMRs) in Espoo: Im Jahr 2022 hat das finnische Ministerium für Wirtschaft und Beschäftigung eine umfassende Reform des Kernenergiegesetzes (NEA) von 1987 auf den Weg gebracht, die auch die Regulierung von kleinen modularen Reaktoren (SMR) (z. B. Genehmigungen) als Beitrag zur Dekarbonisierung der Strom- und Wärmeerzeugung berücksichtigt. Der Entwurf wird voraussichtlich 2024 zur Konsultation vorgelegt, während das Gesetz voraussichtlich 2028 in Kraft treten wird. Das NEA legt unter anderem die Entscheidungsbefugnisse der Standortgemeinde und die Anhörung der Einwohner*innen fest. Die Stadt Espoo prüft derzeit die Möglichkeit, einen SMR in der Stadt anzusiedeln. Die Initiativewurde 2017 gestartet, und die Stadt untersucht den Standort der Anlage. Wenn die Anlage an das Fernwärmenetz angeschlossen werden soll, müsste sie relativ nahe an dichten städtischen Siedlungen liegen. Die Beteiligung der Anwohner*innen an der Entscheidungsfindung würde somit zu einer Schlüsselfrage. Die umfassende Reform der NEA schafft einen Rahmen für die Entscheidungsfindung, die Kommunikation und die Beteiligung der Öffentlichkeit. Die Fallstudie wird es ermöglichen, die Erwartungen der wichtigsten Interessengruppen (lokale Entscheidungstragende, Energieunternehmen, Ministerium, Behörde für nukleare Sicherheit usw.) in Bezug auf die Kernenergietechnologie zu untersuchen. Weiters werden die Auswirkungen der Bürger*innenbeteiligung auf die Gesetzesreform und die Verbindung von repräsentativer Demokratie und Bürger*innenbeteiligung aus der Perspektive lokaler Entscheidungstragender untersucht. In dieser Fallstudie werden die verschiedenen Perspektiven der Beteiligten zu einem eher kontroversen Thema berücksichtigt, ohne dass die Installation der Kernenergieanlagen als Voraussetzung für die Deliberation vorgeschrieben wird: Die Stadt Espoo hat noch keine politische Entscheidung über kleine Kernkraftwerke getroffen.
Fallstudie über Aktivismus
CS #4: Activism – Westbahnhof-Areal (AT)

Westbahnhof-Areal: Der Westbahnhof in Wien teilt das umliegende Stadtgebiet seit Mitte des 19. Jahrhunderts in zwei unterschiedliche Bereiche, wobei finanzielle Zwänge die Integration des nördlichen und südlichen Teils verhindern. Im Jahr 2019 rief das Büro für lustige Angelegenheiten (BLA) die Initiative WESTBAHNPARK ins Leben, die sich inzwischen in die beiden Initiativen WESTBAHNPARK.LIVE und WESTBAHNPARK.JETZT aufgeteilt hat. Diese Initiativen setzen sich für die Umwandlung einer 1,2 Kilometer langen Bahntrasse hinter dem Westbahnhof in einen öffentlichen Park ein. Dies stellt eine Chance dar, den Grünraum in Rudolfsheim-Fünfhaus zu vergrößern, einem der am dichtesten besiedelten Bezirke Wiens, wo die Grünfläche pro Kopf nur 3 m² beträgt. Das Projekt zielt darauf ab, die städtische Hitze zu mindern, die Luftströmungskorridore zu verbessern und die Verbindung zwischen den nördlichen und südlichen Teilen des Bezirks durch taktischen Bottom-up-Urbanismus zu verbessern (Lydon & Garcia, 2015). Die Installation der längsten schwimmenden Mähne der Welt ist ein Meilenstein der bisherigen Intervention. Mit mehr als 11.700 Unterschriften hat die Initiative erhebliche öffentliche Unterstützung erhalten. Im Jahr 2022 entwickelte die Stadt Wien in Zusammenarbeit mit den ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) ein formelles Stadtentwicklungskonzept „Mitte 15“ für das Gebiet um den Westbahnhof. Es wurde ein partizipativer Prozess eingeleitet, bei dem Stadtpolitiker, Planer und Anwohner durch Diskussionen, Workshops und Virtual-Reality-Simulationen einbezogen wurden. Die aktuelle Version sieht fragmentierte Grünflächen, Terrassen für den öffentlichen Raum, Wohnprojekte, Tiefgaragen, ein Logistikzentrum und zusätzliche Querungen der das Viertel trennenden Bahngleise vor. Die Initiativen WESTBAHNPARK.LIVE und WESTBAHNPARK.JETZT kritisieren diesen Plan und schlagen eine klimafreundliche, naturnahe Gestaltung mit Bäumen und Wasserflächen vor. Diese Fallstudie ist ein anschauliches und eindringliches Beispiel für eine manifeste politische Beteiligung, die darauf abzielt, ein städtisches Gebiet von unten nach oben in einen öffentlichen Raum und einen Erholungsraum zu verwandeln. Der ständige Dialog zwischen der Stadt, der Initiative und den Bewohnern ist entscheidend für die Gestaltung der Zukunft dieses Projekts und die Gewährleistung einer gemeinschaftlichen, nachhaltigen städtischen Transformation.